
Neben dem WhatsApp-Icon auf meinem Handy leuchtet eine Zahl in rot auf.
23 bislang unbeantwortete Nachrichten.
Beschämt lasse ich das Handy wieder in der Tasche verschwinden.
Ich denke oft darüber nach wer ich bin, und wer ich sein will und meistens muss ich dafür gar nicht so philosophisch werden:
Solange ich mit mir selbst ein Bier trinken und ein High five geben würde, war eigentlich alles im Lot.
Die Wahrheit der letzten Jahre ist aber: das war nicht besonders oft der Fall.
Ich hatte das Gefühl, dass ich nach dem Krebs wieder sozialisiert werden musste.
Ich war unverbindlich, grenzsetzend, verletzlich, reizbar, oft frustriert.
Ich war sensibel und richtend, verständnislos und ungeduldig.
Ich war müde, desinteressiert.
Zu ehrgeizig, zu einnehmend und oftmals neidisch.
Und ehrlich?
Das ist anstrengend. Ich fand mich oft selbst anstrengend. Sche**e.

Reflektion eigener Verhaltensweisen wird oft als Non-plus-ultra eines guten Charakterzuges definiert, aber holla die Waldfee- angenehm ist es nicht.
Bei Anderen ist das weniger problematisch: man kann dem Gegenüber kurz spiegeln, was auffällt und dann mit gutem Gewissen nach Hause gehen.
Ich konnte nicht nach Hause gehen.
Ich stand mir selbst 24 Stunden des Tages gegenüber.
Es sind nicht immer die anderen schuld.
Ich fand mich selbst an vielen Tagen unheimlich unsympathisch. (Und offen gesagt: Ich war es auch).
Ich möchte ehrlich mit euch über Krebs sprechen und auch über das Leben danach.
Über die Ambivalenz.
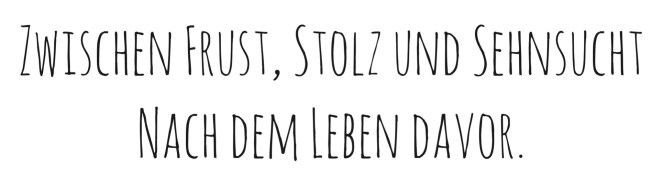
Empört war ich, als Andere die Normalität meines Lebens bestimmen wollten.
Haare gut, alles gut.
Dass ich wenige Monate zuvor meine Lebensentwürfe am Empfangsthresen der Onkologie abgegeben hatte, meine Dinge geklärt und Erinnerungen für mein Kind schaffen wollte, meine Familie beweint und Termine wahrgenommen hatte, die weder verschieb- noch verhandelbar gewesen sind, um schließlich wieder am Anfang zu stehen.
Ich hatte Ängste, die mir so unfassbar nah waren. So nah, dass die Monster unterm Bett unlängst am Abendbrottisch wie selbstverständlich mitaßen.
Sie waren in meinem Alltag und ließen sich nicht einfach so mit Haarreifen und Spangen hinausbitten.
Ich konnte nicht wie Cowboy Joe mit zwei geladenen Konfettikanonen am Colt in den Saloon des Lebens treten und mich winkend wieder ins pulsierende Leben schmeißen.
Zu tief die Narben, zu groß die Ängste und zu krass die Konsequenzen.
Auf der anderen Seite, war da aber auch Stolz im Spiel.
Keine Extrawurst. Kein Krebsbonus mehr. Das Bedürfnis normal behandelt zu werden.
„Vier Wochen Wiedereingliederung reichen mir!“, „Ich organisiere das Klassenfest gern mit“,
„Ich möchte wieder fit werden, gern begleite ich dich zum neuen Kurs“.
Frust, wenn es nicht geklappt hat. Streng genommen nichts geklappt hat, was ich unternommen habe wieder ein normales Leben aufzunehmen.
Ich hatte Sehnsucht nach der Selbstverständlichkeit des Lebens vor der Erkrankung.
Ich wollte kein Bier mit mir trinken.
Und oftmals nicht einmal mit anderen.
Wer war ich eigentlich geworden im unbeständigen Wunsch mir selbst treu zu sein und zu bleiben wie ich bin? Welchen Raum gebe ich einer Erkrankung, für deren Abspann es keine richtige Erklärung gab.
War man krebsfrei? Gesund? In Heilungsbewährung, oder Remission?

Ich war hart.
Grenzen zu setzen ist kein Leichtes und oft genug schoss ich übers Ziel hinaus und fühlte mich danach missverstanden.
Das „nein!“ zu grob gesagt. Nachrichten nicht beantwortet, weil ich die Worte oftmals nicht steuern konnte, manchmal beleidigt und nachtragend. Dünnhäutig und auch erwartend.
Ich wollte all das nicht sein.
Ich war all das eigentlich nie.
Die, die ich war und immer mochte, war zwar zynisch- aber lustig.
Gesellig und liebend. Leidenschaftlich und verbindlich. Unternehmungslustig.
Eine mit Interessen. Eine unkomplizierte, verständnisvolle Person.
Eine, auf die man sich verlassen konnte.
Aber lange Zeit nach dem Krebs war ich all das nicht.
Ich musste diese Person erst einmal definieren und in ein Lebenskonstrukt setzen, deren Rahmenbedingungen zum ersten Mal nicht ich- sondern die Umstände meines Lebens brachten.
Ich weiß, dass viele von euch jetzt nicken und sagen „Das ist völlig verständlich und normal“.
Vielleicht. Es fühlte sich nur leider ganz uns gar nicht normal an.
In meiner Alltagsrealität war ich der Englishman in New York.
Eine Krebserkrankte in einem Umfeld voller gesunder Menschen mit dem Selbstverständnis für die Leichtigkeit des Lebens, die sie mir spätestens nach meinem Wiedereinstieg in den Job wieder zugeschrieben haben.
Haare gut, alles gut.
Heute, einige Jahre später – bin ich wieder da.
Werte, für die ich lange keine Kapazität hatte, tauchen wieder auf.
Fairness, Gerechtigkeit, Kreativität, Respekt, Mitgefühl spielen wieder eine größere Rolle in meinem Kopf, weil wieder Platz darin ist, weiter über den Tellerrand zu gucken.
Die Krankheit dominiert heute keine Strukturen meines Alltags mehr- und den Platz nehmen wieder Dinge ein, die mich umso mehr ausmachen, oder definieren.
Ängste gehören nicht dazu.
Die, die mir wichtig sind, die ich erwarte und die mich im Grunde ausmachen.
Persönliche Erfolge bilden keine guten Blutwerte mehr ab und sind nicht mehr verantwortlich für die Werktags-endorphine.
Heute freue ich mich über Ausgelassenheit, Gespräche am Lagerfeuer, die mich aufladen.
Meine emotionale Kapazität ist nicht mehr (oft) im maximalen Dispo, sondern bietet einen Puffer für ein dickeres Fell und eine handvoll dickerer Geduldsfäden.
Heute geht es mir wieder gut- sehr gut sogar.
Die Zeit hat es gebracht, dass ich mehr als Einschränkungen und Verluste gesehen habe.
Ich schreibe dir das auf, weil ich oft dachte:
„Alles, was geblieben ist, ist ein Trümmerfeld. Wozu war die ganze Anstrengung der Behandlungen gut, wenn ich ein Leben führen soll, das mich so beschränkt?“

Ich habe mich auf Möglichkeiten konzentriert.
Ich bin angekommen. Meine Erstdiagnose nährt sich im Oktober zum sechsten Mal- und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr ganz genau, an welchem Tag das war.
(Das verblüfft mich übrigens sehr: Sind die Daten nicht eigentlich mit dem Reibeisen in sie Seele gebrannt?)
Ich habe immer versucht, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen und vielleicht ist das der Grund, warum ich überhaupt noch lebe. Und einfach war all das nicht.
Heute, mit etwas mehr Distanz kann ich dir sagen: Ich muss das nicht mehr. Es ist anstrengend, Ressourcen aus Möglichkeiten zu heben.
Meine WhatsApp- Nachrichten sind immer noch oft unbeantwortet.
Es ist nicht mehr mein Anspruch geworden einem alten Leben nachzueifern, sondern mir ein neues, lebenswertes aufzubauen.
Dafür brauche ich kein Bild eines vergangenen Lebens vor dem Krebs mehr.
Nur ein Teil davon ist mir heute wichtig geblieben:
Dass ich gern so lebe, dass ich mit mir selbst ab und zu ein Kaltgetränk trinken würde.
Heute zum Beispiel.
Eure

